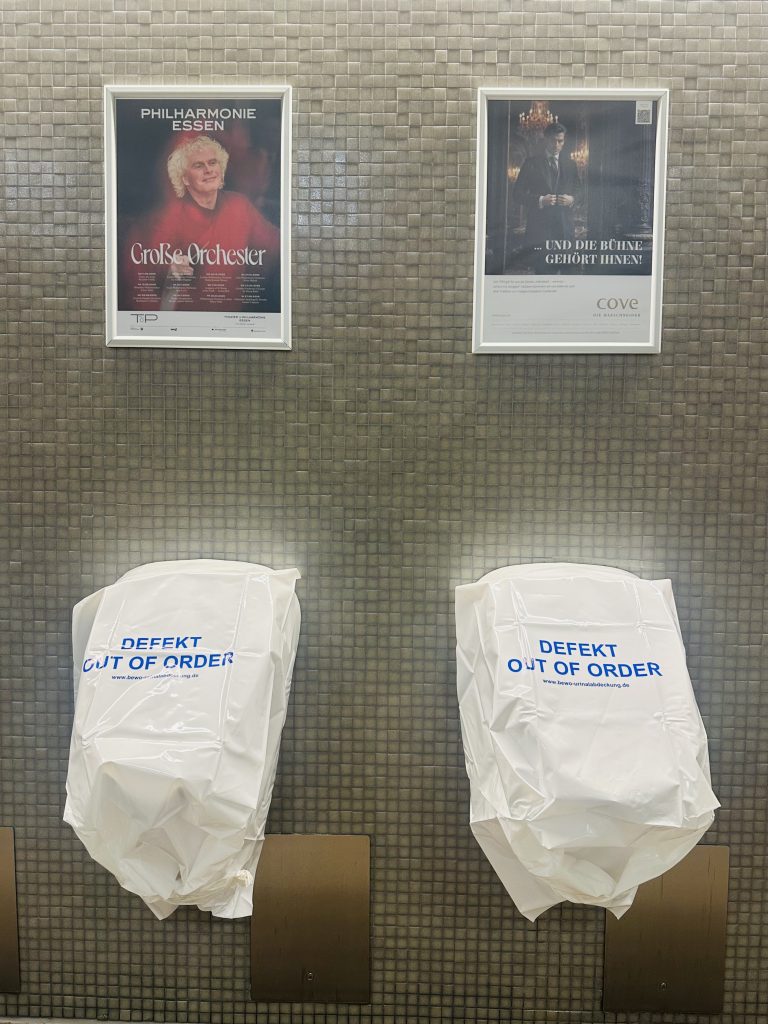Warum verdient der CEO von Volkswagen mehr als 10 Mio. Euro im Jahr? Weil er dafür sorgt, dass VW gute Autos baut und die bestens verkauft? Kann man so sehen. Allerdings ist das nach meinem Verständnis nur ein Teil der Aufgabe. Der wesentlich wichtigere Teil ist, dass die CEO´s ihre Konzerne und Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen. So wie Sir Alex Ferguson, der als Fußballtrainer nicht für die Fitness seiner Spieler bezahlt wurde, sondern für 49 Titel, die er mit seinen Mannschaften gewann. Was im Sport die Titel, sind in der Wirtschaft die Innovationen, die Geschichte schreiben und vor allem profitable Märkte machen. Innovationen, die nicht nur andere Produkte und Prozesse alt aussehen lassen, sondern obsolet machen respektive „zerstören“.
Und du, Deutschland? Willst du auch wieder Titel gewinnen? Exportweltmeister warst du 2009 zum letzten Mal. Und in der Innovationsliga der WIPO bist du auch nicht mehr unter den Top Ten. Im Bundesliga-Fußball würde man sagen, dass dein Platz jetzt in der unteren Tabellenhälfte ist. Bei dem seit 1969 vergebenen Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften stand Deutschland mit Reinhard Selten 1994 auch nur ein einziges Mal auf dem Siegertreppchen.
Apropos Wirtschaftsnobelpreis. Der ging dieses Jahr an drei Ökonomen, die das Zusammenspiel zwischen Innovation und Wachstum untersuchten. Inhaltlich knüpften sie an Schumpeters These der „kreativen Zerstörung“ an. Damit sind strukturelle Verwerfungen in der Wirtschaft gemeint, die ganze Wettbewerbssysteme neu ordnen. Die deutsche Automobilindustrie spürt den Wandel gerade schmerzlich. Die Arbeiten der Preisträger zeigen aber auch auf, wie stark das Thema der Innovation ein politisches geworden ist. Jede im Markt erfolgreiche Innovation bringt radikale Veränderungen mit sich – es gibt nicht nur Gewinner in der Wirtschaft, sondern auch Verlierer, die das Sozialsystem auffangen muss. Die Politik wird im Zusammenspiel mit der Wirtschaft und auch der Wissenschaft ihre Rolle und ihre Wirksamkeit neu definieren müssen. Nicht als „Ausputzer“, wenn es zu spät ist, sondern als prophylaktischer Möglichkeitsraum-Gestalter. Je eher sie diese Rolle proaktiv annimmt, desto schneller kommt unsere Volkswirtschaft wieder aus dem Leistungstief.
Deutschland braucht ein neues, gesellschaftsrelevantes Verständnis von Innovation. Akzeptiert man die Verbindung zwischen Innovation und Wachstum, dann muss allen die ungeheure Tragweite klar werden, die sich aus einem Missachten dieses Konnexes ergeben. Man wird überrollt und zum Zuschauer am Platzrand degradiert. Makroökonomie, Geopolitik und Technologieschübe gehören auf die Agenda der Bildung einer Volkswirtschaft, die noch (!) die drittgrößte der Welt ist. Eine Gesellschaft, die meint, sich auf Lorbeeren ausruhen zu können, muss wissen, dass Innovation und Fußball dem Ergebnis-Prinzip folgen – man muss immer ein Tor mehr schießen als der Gegner!